STEINE UND SAGEN - mythologie-atlass Webseite!
Christina Schlatter: Steine und Sagen
Christina Schlatter, St. Gallen ist Mitautorin des Buches "Quellen, Kulte, Zauberberge" Im nachfolgenden Beitrag beschreibt Sie den Steinkult allgemein und wichtige Kultsteine in der Ostschweiz. Die Bilder im Text beziehen sich auf Steine im Allgäu und Außerfern
Von sagenhaften Steinen
und
warum an Steinen Sagen haften
Sagen tradieren vorgeschichtliche Mythen und Kulthandlungen. Was über tausende von Jahren Bewusstsein und Handeln prägt hinterlässt Spuren bis heute. Steine haben Namen, sie weisen bestimmte Formen oder Körpereindrücke auf. Bei ihnen zeigen sich Schlangen und Schätze, man opfert auf Steinen, holt neugeborene Kinder darunter hervor. Tonnenschwere Findlinge lassen sich mit Leichtigkeit tragen oder drehen. In den Märchen werden Menschen in Steine verwandelt. Solche Motive entstammen frühen Epochen, sind jedoch überlagert von späteren Schichten, in denen sich Patriarchalisierungs- und Christianisierungsprozesse spiegeln.
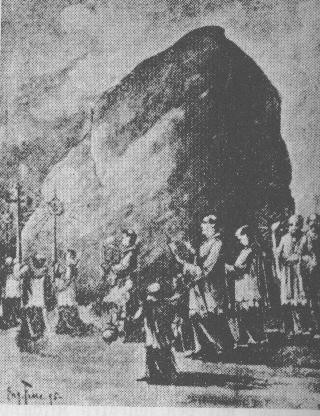
Woher die Steine kommen
- · Im Walliser Lötschental erscheint eines Tages eine Zwergenfrau, d’Holzmüeterä, sie trägt einen gewaltigen Steinblock auf dem Rücken und strickt dazu noch ein Zwergenkleid. Weil sie von den Menschen geneckt wird, stellt sie den Klotz ab, dort wo er heute noch tief im Boden steckt · Der Riese vom Calfeisental transportiert einen Mühlstein von Mels bis nach Vättis hinauf. Andere sagen, der Block sei vom nahen Berg heruntergerollt. Beim Stein treffen sich die Hexen zum Tanz · Am alten Wallfahrtsweg auf die Rigi steht ein ofengrosser schwarzer Marmelstein. Damit will der Teufel den Neubau der Kapelle Maria zum Schnee verhindern. Ein altes Mütterchen überrascht ihn, ruft erschrocken „Jesses Maria“, daraufhin muss er den Koloss absetzen. Noch heute sieht man die Krallenspur ·
Die Steinverehrung reicht in die Jungsteinzeit zurück, entwickelt aus den paläolithischen Höhlenkulten. In flachen Gegenden baut man künstliche Höhlen und Hügel als megalithische Grabanlagen. Sie beherbergen die Verstorbenen eines Clans, dienen Kulthandlungen und astronomischen Messungen. Noch heute bleibt mancherorts rätselhaft, wie die tonnenschweren Blöcke über weite Strecken transportiert wurden. Wenn auch die Findlinge in den Alpengebieten nicht von Menschenhand an ihren jetzigen Ort gelangten steckt doch in mancher Sage diese Erinnerung mit drin. Steinsetzungen sind ein Werk von Generationen, eine „riesige“ Aufgabe zur Ehre der Grossen Göttin. Hinzu kommt die Vorstellung der Landschaft als Frau, naheliegend also, wenn sie Steine auf ihrem Rücken trägt.
Eingang zu den Schätzen der Anderswelt
· Ein Jagdhund schlüpft unter den Römerstein von Lenzburg. Wie von Geisterhand dreht sich der gewaltige Stein, gibt eine Treppe und einen langen Gang frei, zuhinterst ein Tor. Steinalte bärtige Gesellen bewachen eine Schatzkiste · Das Regeli, eine seltsame alte Frau lebt einsam in ihrer zerfallenen Hütte. Einmal im Jahr am Karfreitag steigt sie vor Sonnenaufgang auf den nahen Berg und lässt sich von der aufgehenden Sonne bestrahlen. Noch heute trägt der Stein ihren Namen. Es heisst, wer das Regeli erlöst, gewinnt einen grossen Schatz · In Längenfeld wohnen vor Zeiten wilde Fräulein. Sie graben sich dort eine neun Stufen tiefe Höhle. Auch haben sie einen eigenen Stein, auf dem sie sich sehen lassen, er heisst nach ihnen Frauenstein. Man sieht sie oft auf demselben sitzen, wie sie ihre blonden Haare kämmen und schöne Lieder singen. Naht sich ein Mensch, so ziehen sie sich schnell in die Höhle zurück · Beim Entfernen eines erratischen Blockes in der Bettelmatt entdeckt man unter dem Stein vier Beilklingen ·
In den Alpengebieten gibt es nur vereinzelt Steinsetzungen. Überall aber bieten imposante Steine und Findlinge natürliche Objekte, um von den Menschen beachtet zu werden. Weisen sie höhlenähnliche Vertiefungen, Durchschlupfe oder Löcher auf, können sie zu Ahninnensteinen[1] werden und den Eingang zur Anderswelt markieren. Zuweilen sind die Steine künstlich bearbeitet mit Schalen, Rinnen oder Kerben. Bärtige alte Gesellen sind Verstorbene, sie warten auf ihre Rückkehr ins Leben. Schätze verwandeln sich in der neuen Vegetationsperiode in blühende Felder, wenn sie von der erstarkenden Frühlingssonne bestrahlt werden. Das Regeli, die Winteralte, vollzieht ein Frühlingsritual, in dessen Verlauf vielerorts Weihegaben niedergelegt werden, wie archäologische Depotfunde unter Steinen belegen.

Aus den Steinen kommen die Kinder
· Unter dem grauen Stein von Biel gräbt man die Kinder hervor · Alter Weiber Morgengabe heisst ein eiförmiger Fels, der frei aus dem Vierwaldstättersee hervorragt. Aus diesem Fels werden die kleinen Kinder geholt · In der Umgebung von Lenzburg gibt es mehrere Granitblöcke, die von einem Steinregen herrühren. Die Hebamme nimmt diejenigen Kinder zuerst, die am lautesten schreien, deshalb weiss man nicht im Voraus, ob es ein Bübchen oder ein Mädchen wird · Man muss dreimal an den Stein klopfen oder dreimal um den Stein herumgehen · Aus der Höhle des Rosensteins werden die Kinder von der Weissen Frau gereicht · Frauen mit Kinderwunsch rutschen über Steine oder stellen den Fuss in den Lochstein, aus dem das Wasser bei der Verena-Quelle sprudelt ·
Steine markieren Grabstätten und Eingänge zur Anderswelt, dort entsteht gemäss den alten Wiedergeburtsvorstellungen neues Leben. An diesen regenerativen Orten des Erdschosses halten sich die Seelen der Verstorbenen auf, behütet von der Urahnin, der Weissen Frau, der Heiligen Verena. Durch Berührung mit dem Stein kommt es zu einer spirituellen Empfängnis, deshalb rutschen Frauen auf den Steinen. Eine Verbindung mit Wasser verstärkt die Symbolik. Unter Steinen hervorsprudelndes Wasser ist Lebenswasser aus dem Schoss der Ahnin-Göttin.

Heilende Steine
Aus dem Wiedergeburtsglauben wird auch verständlich, warum viele Steine heilende Wirkung haben. Ihre lebenschöpfende Kraft vermag Krankheiten zu überwinden.
- · Beim Grabmahl der heiligen Idda gibt es einen Lochstein, dort stecken Pilger die schmerzenden Füsse hinein · In Einsiedeln hält man erkrankte Glieder in die Höhlung eines erratischen Blockes · In Skandinavien salbt man die Steine gegen Krankheiten · Aus Steinen wird heilsames Steinmehl gewonnen ·
Körperspuren im Stein
- · Am Gonzen versucht eine Hexe auf die andere Talseite zu fliegen, es misslingt, ihre Fussspuren bohren sich in den Stein, auf dem sie landet · Auf dem Weg zur Tumpener Alm kommt man zu einer Stelle, die „Am Truttefuss“ heisst. Es gibt dort eine etwas erhöhte Steinplatte, auf der merkwürdige Vertiefungen zu sehen sind; eine sieht aus wie ein Menschenfuss, eine wie ein Kuhfuss und die dritte wie ein Ziegenfuss. Diese Eindrücke auf der Platte rühren von einer Trude her, die da darüber gegangen ist. Auch wird die Steinplatte „Der Hexentanz“ genannt ·Der wilde Mann und die Langtüttin kommen oft im Pillerberg zusammen, dort wo jetzt noch der weisse Stein liegt. Noch sieht man vom wilden Mann die eineinhalb Spannen grosse Fussstapfe. Sein Stecken drückt dem Sesselstein, an dem er lehnt eine solche Vertiefung ein, dass eine grosse Rinne entsteht. Ebenso sieht man noch genau im Felsen, wo er sitzt und wo er den Zwirnknäuel und das Strumpfelbrett hinlegt, dort sind Rillen eingedrückt. So sitzen sie oft stundenlang beisammen und spielen · Drei Löcher zeugen von einem falschen Schwur um Bodenbesitz, tief graben sich die Schwurfinger in den Stein, der seither den Namen Dreifingerstein trägt · Oraspighel (Eulenspiegel) und der Teufel streiten sich um die Herbsternte im Oberhalbstein. Wütend schleudert der Teufel einen Stein, verfehlt seinen Kumpanen. Das Geschoss schlägt ein Loch in den Piz d’Aela. Weil er beim Werfen ausrutscht, gräbt sich sein Knie in eine Platte am Boden. Durch das Loch im Piz scheint zu Zeiten die Morgensonne auf den Kniestein und wenn sich das Wasser darin sammelt, nennt man es Teufelswein · Der Riese Bernard liegt trauernd auf einem Steinblock bis zu seinem Tod, weil seine Liebe zur Blanche, der Weissen Frau, unerwidert bleibt, sein ganzer Körper ist darin abgedrückt. Man nennt den Stein „la pierre du sauvage“ ·
Im Stein verkörpert sich die Ahnin-Göttin selber oder ihr männlicher Partner, der als Kulturheros die Belange der Menschen und der Natur vertritt. In den Sagen wird sie zur wilden Frau, abgewertet zur Trude oder Hexe, er ist der Riese, der wilde Mann oder entsprechend dämonisiert der Satan. Der Heros manifestiert sich oft in Tiergestalt (Totemtier) als bocksfüssiger Teufel. Auch die Göttin zeigt sich zuweilen in Tierform, als Vogel, Kuh, Ziege oder Füchsin, davon zeugen die Spuren auf den Steinen. Sie verweisen auf göttliche Anwesenheit und vermitteln numinose Kraft.

Steine im Jahreskreis
- ·An Fronfasten, den Johannestagen und um Peter und Paul erscheint jeweils ein Lichtlein beim Geissbergerstein · Der Zwölfistein in Biel dreht sich an Quatembertagen, jener in Ins täglich am Mittagspunkt der Sonne. Er heisst Schallenstein und hat seinen Namen vom Schallen der Schellen, die an bestimmten Tagen im Jahr die Flurumgänge und Prozessionen zum Stein begleiten · Hauptfeiertage beim Fridolinstein in Rankweil sind der 1. Mai und der 2. Juli. Am Vorabend zum Maifest, in der Walpurgisnacht, gibt es eine grosse Lichterprozession zum Stein · Den Hexenstein von Terenten (Südtirol) fürchten die Bauern, denn dort feierten die Hexen einst die Sommersonnenwende. Bei Grabungen werden Kohlenreste festgestellt, in der Nähe befindet sich eine Platte mit schönen Schalen ·
Zeitangaben in den Sagen sind oft an jahreszeitlich relevante Daten gebunden. Die Benennung folgt christlicher Terminologie, dahinter verstecken sich heidnische Kultfeste mit astronomischem Bezug zu den Sonnenwenden und zum Bauernkalender. Der häufig genannte vierteljährlich wiederkehrende Termin Quatember oder Fronfasten entspricht Festdaten, die aus keltischer oder antiker Überlieferung bekannt sind. Hinzu kommen die grossen Sonnwendfeste an den Eckpunkten des Jahres, die heute christlich begangen werden. Für die Menschen sind solche Kultfeste von grosser Bedeutung, denn sie helfen, die Kräfte der Natur zu entfalten und die Fruchtbarkeit der Erde für die Acker- und Viehwirtschaft sicherzustellen.


Opfer- und Weihegaben
- · Kleidergeschenke für die Wildleute werden auf Steinen dargebracht, für die Percht und die Wilde Frau legt man Speisen auf Kreuzwege und Feldsteine · In den Schalensteinen deponiert man Milch- und Speiseopfer, noch bis in jüngste Zeit legen Hirten in Bignasco Alpkäse in die Schalen, um die Berggeister günstig zu stimmen · Die Schlange beim Crap von Bargnan fordert beim Vorbeigehen jeweils das schönste Stück der Herde · Jedem jungen Zicklein, das den Beusch, einen überhängenden Felsblock besteigt, wird auf geheimnisvolle Weise der Hals umgedreht.
Dämonisierung, Christianisierung, Industrialisierung
- · Der Teufel will einen gewaltigen Stein, den er am Fuss der Alpen findet auf die Kirche von Huttwil schleudern. Höhere Gewalt hindert ihn daran. In seinen Händen glühend geworden lässt er den Block fallen · Von einem Priester stammen Fussabdrücke, er bannt die Geister, die in den grossen Steinen leben, ein harter Kampf mit vielen Beschwörungsformeln · Der heilige Gallus drückt seine Spuren beim Kampf mit dem Bären in den Stein. Andere sagen, die Fussspur sei durch das Scharren während des Predigens entstanden. Der Stein ist heute in die Wand der Galluskapelle eingemauert · Beim Bau der Gotthardstrasse wird der Geissbergerstein gesprengt. Seither hat man dort nie mehr etwas Ungehöriges bemerkt ·
Das Ausrotten des alten Glaubens hat System. Göttin und Heros werden dämonisiert (Hexe, Teufel), Kulthandlungen negativ benannt („Geisteraustreibung“), Kultsteine christlichen Heiligen zugeschrieben, in Kirchenbauten integriert oder verteufelt und mit Angst belegt. Noch die Moderne setzt diesen Trend fort. Steine sprengt man gewaltsam in die Luft oder versenkt sie meliorierend in den Boden. Bei Notgrabungen gelangen sie zuweilen ins Museum. Sagen und Überlieferungen? Aus dem Gedächtnis der Internet-Generation deleted. Sie wieder zu entdecken, könnte heilsam sein für die Natur und unsere Seelen.

Literaturauswahl:
Ötztal-Archiv (Hrsg.): Sagen und Geschichten aus den Ötztaler Alpen. Innsbruck 1997
Jantsch, Franz: Kultplätze im Land der Berge. Band V: Tirol, Südtirol, Vorarlberg. Unterweitersdorf 1995
Büchli, Arnold: Sagen aus Graubünden. Aarau (ohne Jahr)
Bloetzer, Hans: Steinalte Sagen aus Lötschen. Eigenverlag (ohne Jahr)
Schmalz, Karl Ludwig: Namensteine und Schalensteine im Kanton Bern. Bern 1988
Kuoni, Jakob: Sagen des Kantons St. Gallen (Nachdruck). Zürich 1986
Michel, Hans: Ein Kratten voll Lauterbrunner Sagen. Interlaken (ohne Jahr)
Rochholz, Ernst Ludwig: Schweizersagen aus dem Aargau. Aarau 1856
Halder, Nold: Aus einem alten Nest. Sagen und Spukgeschichten aus Lenzburg. Aarau 1923
Göttner-Abendroth, Heide: Die Göttin und ihr Heros. München 1997
Christina Schlatter
Lic. phil.
Biserhofstrasse 29
CH-9011 St. Gallen
